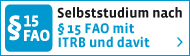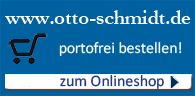Freispruch als Behördenversehen oder schlicht richtige Entscheidung des Landgerichts Hannover?
Viele Medien berichteten kĂĽrzlich, dass ein Millionen-BuĂźgeld wegen Datenschutzverstößen nicht bezahlt werden mĂĽsse – aufgrund eines Formfehlers der Staatsanwaltschaft. Entsprechende Schilderungen kann man etwa bei Spiegel, Tagesschau und Bild nachlesen. Tatsächlich konnte das Unternehmen vor dem Landgericht Hannover einen rechtskräftigen Freispruch erzielen. Der folgende Ăśberblick beleuchtet einige wesentliche Aspekte des Verfahrens, des Freispruchs und auch die GrĂĽnde, die fĂĽr eine RĂĽcknahme der zuvor von der Staatsanwaltschaft eingelegten Rechtsbeschwerde sprachen.
A. Das Verfahren
Im Jahr 2022 verhängte der Landesbeauftragte für Datenschutz Niedersachsen (LfD) ein Bußgeld von 4,3 Millionen Euro gegen Volkswagen. Das Landgericht Hannover wies die Rechtsauffassungen der Behörde zurück und sprach das Unternehmen von allen Vorwürfen frei. Parallel dazu hatte der LfD auch verwaltungsrechtliche Verwarnungen ausgesprochen, von denen das zuständige Verwaltungsgericht Hannover einige aufhob. Die Staatsanwaltschaft nahm ihre Rechtsbeschwerde gegen den Freispruch wenige Tage nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts zurück. Der Freispruch des Landgerichts Hannover wurde dadurch mit sofortiger Wirkung rechtskräftig.
B. Datenschutzrechtliche VorwĂĽrfe des LfD
Der LfD warf Volkswagen vor, Beschäftigte nicht ausreichend über die Verarbeitung ihrer Daten im Rahmen des US-Monitorships informiert zu haben. Die Behörde argumentierte, die Übermittlung von Daten an den US-Monitor sei zwar zulässig gewesen. Es habe aber eine Pflicht zur erneuten Information wegen sogenannter Zweckänderungen bei der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 4 DSGVO gegeben. Das Landgericht Hannover wies diese Argumente zurück und stellte fest, dass die umfassende Informationspolitik von Volkswagen sehr wohl ausreichend war. Zudem gab das Gericht einige Antworten auf Fragen, die sich bei Verfahren mit Datenschutzbehörden häufiger stellen.
I. Personenbezug
Ein Ausgangspunkt des Verfahrens war, ob und bei welchen Verarbeitungen es überhaupt noch um personenbezogene Daten ging. Volkswagen hatte Daten vor der Übermittlung an den Monitor grundsätzlich geschwärzt oder verschlüsselt, sodass für den Monitor keine direkte Identifizierbarkeit oder Möglichkeit zur Zuordnung bestand. Das Landgericht Hannover folgte der Auffassung des Unternehmens, dass die Weitergabe zuvor pseudonymisierter Daten für den Monitor eine Anonymisierung darstellt und auch deshalb keine zusätzliche Information betroffener Beschäftigter erforderlich war.
II. Zweckänderung
Der LfD hatte in seinem Bußgeldbescheid zudem argumentiert, dass eine erneute Information aufgrund von Zweckänderungen nach Art. 6 Abs. 4 und Art. 13 Abs. 3 DSGVO nötig sei. Das Landgericht Hannover lehnte schon die Voraussetzungen einer Zweckänderung ab. Die vom Unternehmen zuvor festgelegten Zwecke (darunter unter anderem auch die Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses sowie die Verteidigung, Abwehr und Geltendmachung von Rechtsansprüchen) umfassten auch die Weitergabe von Informationen an den Monitor. Das Landgericht Hannover stellte zudem fest, dass die Übermittlung der Daten auf bereits zuvor festgelegten und kommunizierten berechtigten Interessen beruhte. Eine zusätzliche und erneute Information der Mitarbeiter sei nicht erforderlich. Das Unternehmen habe die Belegschaft zuvor umfassend und hinreichend über die mögliche Weitergabe von Informationen an den US-Monitor informiert.
III. Kenntnisstand der Beschäftigten
Die Richter hatten intensiv geprüft, wie das Unternehmen seine Beschäftigten über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten unterrichtet hatte. Hierfür werteten die Richter umfassend vorgelegtes Informationsmaterial aus und berücksichtigten auch Zeugenaussagen. Das Landgericht Hannover entschied auf dieser Basis, dass aufgrund der umfassenden vorherigen Information der Beschäftigten durch Volkswagen keine weitergehene individuelle Unterrichtung notwendig war.
C. Paralleles BuĂźgeldverfahren und verwaltungsgerichtliches Verfahren
Neben dem Bußgeldverfahren hatte der LfD auch Verwarnungen ausgesprochen. Diese wurden teilweise aufgehoben. Das Verwaltungsgericht konnte diese behördlichen Entscheidungen anders als das Landgericht nur eingeschränkt überprüfen, etwa im Hinblick auf die Ermessensausübung. Es hob mehrere Verwarnungen auf, urteilte aber auch, dass drei dieser Verwarnungen einer gerichtlichen Überprüfung standhielten.
Darunter interessanterweise auch die Verwarnung wegen des Sachverhalts, bezüglich dessen das Landgericht Hannover das Unternehmen zuvor schon freigesprochen hatte. Hier bewertete das Verwaltungsgericht die Sach- und Rechtslage anders als das Landgericht und nahm einen leichten Verstoß an. Dabei hatte das Verwaltungsgericht auch intensiv geprüft, ob schon eine (bekanntlich nicht kostenbewehrte) Verwarnung bezogen auf den vorgeworfenen Verstoß schon eine zu strenge Sanktion sein könnte. Dies konnte das Verwaltungsgericht jedoch nur eingeschränkt überprüfen, da es nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle des Ermessens der Behörde setzen dürfe. Diese Ausführungen in der mündlichen Urteilsbegründung dürften den Vertretern des LfD nicht gefallen haben, nachdem ihre Behörde zuvor ja wegen genau dieses Sachverhalts eine Geldbuße vonn 4,3 Millionen Euro verhängt hatte.
E. Keine Doppelbestrafung im Datenschutz
Das Verbot der Doppelbestrafung (ne bis in idem) gilt übrigens auch im Datenschutzrecht. Erwägungsgrund 148 Satz 2 DSGVO regelt sogar ausdrücklich, dass eine Verwarnung nur anstelle einer Geldbuße, aber nicht zusätzlich verhängt werden kann. Die parallele Verhängung von Verwarnung und Bußgeld wäre auch nach der Rechtsprechung des EuGH zu unionsrechtlichen Sanktionen unzulässig. Auch dies könnte ein weiterer Grund für die Rücknahme der Rechtsbeschwerde nur wenige Tage nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts gewesen sein.
F. Weitere mögliche Gründe für die Rücknahme der Rechtsbeschwerde
Die Entscheidung des Landgerichts Hannover war vor allem aber sachlich richtig sowie umfassend und zutreffend begründet. Die Rechtsbeschwerde entspricht der strafprozessualen Revision. Das Oberlandesgericht hätte nur eine rechtliche Überprüfung vorgenommen, nicht aber erneut Tatsachen festgestellt. Insofern kann man sich bei hinreichenden revisionsrechtlichen Kenntnissen recht einfach selbst ein Bild davon machen, ob die Entscheidung des Landgerichts Hannover revisionsfest ist oder nicht.
G. Formelle Fehler der Staatsanwaltschaft?
Die Staatsanwaltschaft nahm die Rechtsbeschwerde wenige Tage nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts zurĂĽck – laut Presseberichten wegen einer fehlenden Unterschrift. Ein solcher formeller Fehler bei der Einlegung der Rechtsbeschwerde erscheint hier aber zumindest sehr ungewöhnlich – auch weil an dem Vorgang gleich zwei Behörden beteiligt waren und mögliche Fehler hätten erkennen können.
Gleichzeitig gab es aber durchaus andere GrĂĽnde, die fĂĽr die letztlich erfolgte RĂĽcknahme der Rechtsbeschwerde sprachen.
H. Fazit und Ausblick
Der Freispruch war vor allem deshalb möglich, weil Volkswagen das Monitorship datenschutzrechtlich sehr sorgfältig durchführte. Die Entscheidung verdeutlicht auch die Bedeutung einer gut aufgestellten Verteidigung, die auf der vorherigen Beachtung datenschutzrechtlicher Fragestellungen aufsetzen kann. Der Freispruch zeigt auch, dass es sich durchaus lohnen kann, sich vor Gericht gegen Entscheidungen der Datenschutzbehörden zu wehren, wenn man sie für rechtlich falsch hält.
Hinweis: Ein ausführlicher Bericht mit einer detaillierten Analyse erscheint in einer der nächsten Ausgaben der CR. Der Verfasser war als Verteidiger an dem Verfahren vor dem Landgericht Hannover und als Prozessvertreter an dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Hannover beteiligt.